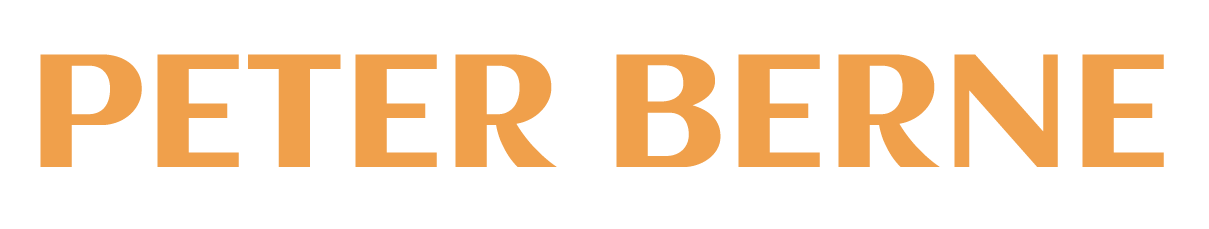Luigi Ricci
... und die mündliche Überlieferung in der italienischen Oper(Die folgenden Ausführungen sind ein Auszug aus dem Buch „Belcanto – Auffühgrungspraxis in der italienischen Oper von Rossini bis zum frühen Verdi – ein praktisches Lehrbuch“ von Peter Berne)
Für manchen Musiker hat das Wort „Tradition“ heute einen schlechten Beiklang; man denkt dabei an eine Anhäufung willkürlicher Bräuche, die sich im Laufe der Zeit wie eine dicke Kruste über das Werk selbst, wie es vom Komponisten erdacht und gewollt war, gelegt und dieses bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet habe. Solche „schlechte“ Tradition gibt es natürlich auch; auf sie trifft das berühmt gewordene Wort Gustav Mahlers zu, nach welchem Tradition nichts anderes sei als Schlamperei.
Hier soll aber von einer ganz anderen, ja geradezu entgegengesetzten Art von Tradition die Rede sein, und zwar von jener mündlichen Überlieferung, die es in dieser Form vielleicht nur in Italien gegeben hat, und die, von Generation zu Generation weitergegeben, nicht nur den Stil einer vergangenen Epoche, sondern auch das authentische Wissen um den Willen der großen Komponisten rein und lebendig erhalten hat. Träger dieser authentischen Überlieferung waren nicht etwa mittelmäßige oder egozentrische Sänger, die ihre eigenen persönlichen Wünsche mit dem usurpierten Titel „Tradition“ zu legitimieren versuchten, sondern gewissenhafte Persönlichkeiten von größtem künstlerischem Ernst, die von einem unbedingten Respekt vor den großen schöpferischen Genies der Vergangenheit erfüllt waren und kein anderes Ziel kannten, als mit allen ihren Kräften diesen Genies und deren Werken zu dienen. Der bedeutendeste dieser Traditionsträger war ohne Zweifel Luigi Ricci.
Die Geschichte der Luigi-Ricci-Tradition beginnt nicht mit Ricci selbst, sondern mit dem Leben und Wirken jenes Mannes, dem er den größten Teil seines Wissens über die Aufführungspraxis der italienischen Oper im 19. Jahrhundert verdankt: Antonio Cotogni.
Cotogni, den seine Zeitgenossen „il re dei baritoni“ („den König der Baritone“) nannten, wurde 1831 in Rom geboren, wo er im Jahre 1852 am Teatro Metastasio als Belcore in Donizettis „L’Elisir d’amore“ debütierte. Zu diesem Zeitpunkt war Donizetti erst vier Jahre tot; die Uraufführung des „Don Pasquale“, die im Theatre Italien in Paris stattgefunden hatte, lag neun Jahre zurück. Zwar sangen die großen Sänger der Rossini-Epoche – wie Garcia, Giovanni Davide oder Filippo Galli – schon seit vielen Jahren nicht mehr; die Malibran war schon tot, und die Zeit von Pastas großen Leistungen war vorbei. Doch viele der Sänger, die die Werke Bellinis und Donizettis uraufgeführt hatten, standen noch auf der Höhe ihrer Kunst und beherrschten nach wie vor die großen europäischen Opernbühnen. Giulia Grisi z.B., für die Bellini die Giuletta in „I Capuleti e i Montecchi“, die Adalgisa in „Norma“ und die Elvira in „I Puritani“, und Donizetti die Norina in „Don Pasquale„ geschrieben hatten, war noch auf der Höhe ihrer Karriere; und mit zwei anderen Größen der Belcanto-Zeit, dem Tenor Mario, der die Rolle des Ernesto in „Don Pasquale“ kreiert hatte, und Giorgio Ronconi, der als der Bariton Donizettis galt und bei zahlreichen Uraufführungen von Donizetti-Opern mitgewirkt hatte, sollte Cotogni wenig später gemeinsam auftreten. Bei einem dieser Belcanto-Sänger sollte er sogar in die Lehre gehen: Von dem berühmten Baß-Bariton Antonio Tamburini, für den die Rollen des Riccardo in „I Puritani“ und des Malatesta in „Don Pasquale“ geschrieben worden waren, ließ sich der junge Bariton die Interpretation des Don Giovanni beibringen.
Jedenfalls war der Belcanto-Stil, zur Zeit, als Cotogni sein Debüt gab, noch in voller Blüte. Cotogni ist in diesem Stil aufgewachsen und wurde auch durch den unmittelbaren Kontakt mit vielen Sängern, die von Rossini, Bellini und Donizetti künstlerisch geformt worden waren, maßgeblich geprägt. In die Operngeschichte ist Cotogni jedoch als der Bariton Verdis eingegangen, mit dessen künstlerischem Entwicklungsweg er als Interpret engstens verbunden war. Schon ein Jahr nach seinem ersten Auftreten, also mit 22 Jahren, hatte er sich an die Partie des Luna in „Il Trovatore“ gewagt; im Jahr darauf kam dann Rigoletto dazu. Danach eignete er sich beinahe alle Baritonpartien Verdis an. Die einzigen Opern des großen Komponisten, in denen er nicht auftrat, waren – abgesehen von einigen Jugendwerken – jene Spätwerke, die zu einer Zeit komponiert wurden, als die stimmlichen Kräfte des Sängers bereits nachließen: „Simon Boccanegra“, „Aida“, „Otello“ und „Falstaff“.
Cotogni galt nicht nur als der bedeutendste Bariton der Verdi-Epoche, sondern überhaupt als eine einzigartige Erscheinung unter den Opernsängern seiner Zeit. Der Ruhm, den er auf der Höhe seiner Karriere genoß, muß ganz außergewöhnlich gewesen sein. „Die Stolz und Cotogni“ – so können wir in einer Kritik aus der „Gazzetta Musicale di Milano“ aus dem Jahre 1870 lesen – „erheben sich auf eine Höhe, die nur von wenigen erreicht, von niemandem jedoch übertroffen werden kann. Cotogni, den man mit recht den Fürsten unter den heutigen Baritonen nennen kann, hat das Publikum entschieden fasziniert. Dieser Sänger mit der mächtigen und weichen Stimme, ist wirklich etwas Außerordentliches.“ Über Cotognis letzten Auftritt in „Don Pasquale“, der ebenfalls 1870 in Venedig erfolgte, schrieb dieselbe Zeitung:
„Während der letzten Vorstellung, die Anfang September stattfand, wurde Cotogni auf außerordentliche Art und Weise gefeiert. Nach nie enden wollendem Beifall im Theater, nach der Überreichung von ich weiß nicht wievielen Lorbeerkränzen, sowie einem Regen von Blumen und Gedichten, wurde er von einer Menschenwoge nach Hause geleitet; unter dem Balkon im Hotel Reale Daniele, wo er wohnte, wurde ihm dann in aller Form eine Serenade dargebracht. Die Chöre und das Orchester des Teatro Malibran, angeführt von Trombini und Acerbi, ihren Leitern, spielten und sangen bis spät in die Nacht hinein, begleitet von den begeisterten Rufen der Menge – circa vier- oder fünftausend Personen…“
Auch von zeitgenössischen Künstlerkollegen wurde Cotogni als eine ganz außergewöhnliche Erscheinung geehrt. Adelina Patti nannte ihn „den besten unter den vielen Kollegen“, die ihr während ihrer langen Karriere begegnet waren; und der Tenor Francesco Marconi, der auf allen großen Bühnen Europas zusammen mit Cotogni gesungen hatte, schrieb über ihren ersten gemeinsamen Auftritt in Bellinis „Puritani“:
„Als ich zur ersten Probe kam … und ihn seine ersten Worte: ‘Or dove fuggo omai’ singen hörte, war ich geradezu erschrocken über diese wunderbare Kunst und sagte, daß ich nicht mehr singen wollte. Was für ein kolossaler Künstler! Jene Gesänge, die, in dieser göttlichen Oper, Bellini schon so groß und eindrucksvoll gestaltet hatte, wurden durch die unvergleichliche Interpretation durch Cotogni noch größer. Und ich schäme mich nicht zu erklären, daß ich „I Puritani“ und einen guten Teil meines sonstigen Repertoires von Toto Cotogni gelernt habe.“
Cotognis Kunst wurde am häufigsten mit dem Wort „nobile“ bezeichnet. Von den Kritiken wurde damals immer wieder seine Fähigkeit, einen bösen Charakter zu veredeln, hervorgehoben; auch sein Spiel soll sich durch besondere Würde ausgezeichnet haben. Er selber sagte einmal rückblickend: „Gewisse überstarke Wirkungen, gewisse allzu wilde oder düstere Erscheinungen haben mir nie gefallen“ – womit er einen Geschmack bezeugt, der eher mit dem Belcanto als mit dem durch extreme Farben und Gefühle gekennzeichneten Stil des jungen Verdi verwandt ist. Dem alten Belcanto muß auch seine Art zu singen nahegestanden haben. Besonders wurde sein „fior di labbra“ gerühmt – womit die Kunst gemeint ist, einen so leichten Ton zu produzieren, daß dieser gleichsam wie eine Blume aus dem Mund hervorwächst. Obwohl Cotogni in der Höhe Töne von schmetternder Kraft von sich geben konnte, war er auch imstande solchen Tönen eine dolcezza zu verleihen, wie man es sonst nur bei höher gelegenen Stimmen zu hören gewohnt war.
Zu den merkwürdigsten Ereignissen seines reichen Künstlerlebens gehörten zwei Begegnungen, die er mit den beiden größten noch lebenden Komponisten seiner Zeit hatte: Rossini und Verdi.
Der Besuch bei Rossini erfolgte 1867 in Passy, wo er durch den Tenor Baragli in das Haus des Komponisten eingeführt wurde. Was Cotogni, der zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt war, dort erlebt, erzählte er später seinem Biographen Angelucci:
„Der große Meister war in Pantoffeln und hatte das Hemd offen, auf dem übrigens eine halbe Dose Tabak umhergestreut lag.
Er wurde durch eine Gesellschaftsdame gestützt, da er schon alt und gebrechlich war. Er setzte sich ans Klavier und wollte, daß ich, in Gegenwart meines Freundes, die cavatina (aus dem „Barbiere“) sang. Ich sang sie, wobei ich sie ohne die abstoßende Kadenz beendete, die viele Künstler machen, um einen besonderen Applaus zu bekommen.
‘So habe ich es geschrieben’, sagte Rossini ernst; und nachdem er eine Zeit lang nachgedacht hatte, improvisierte er, mit jenem ésprit, den er, so alt er auch war, noch unverändert besaß, folgendes ‘strambotto’:
“Non siete fra i baritoni,
Di tal razza asinina,
Che la cadenza storpiano
Ne la mia cavatina!”
“(Ihr seid nicht einer jener
eselhaften Baritone,die meine
cavatina durch eine schlechte
Kadenz verunstalten.)”
Danach lachten wir alle herzhaft, worauf er fragte: ‘Haben Sie einen guten Triller?’ Ich hatte nicht den Mut, mit Ja zu antworten, weil, um die Wahrheit zu sagen, das, was bei mir ein Triller sein sollte, eher ein einfaches tremolo war. ‘Nun gut’, sagte er, nachdem ich geschwiegen hatte, ‘wenn Ihr einmal einen guten Triller habt – und Ihr werdet einen haben – macht ihn zusammen mit der Rosina.’
Und nachdem er dies gesagt hatte, begann er, vom Hundersten ins Tausendste kommend, ein Loblied auf einen bestimmten Spargel zu singen, den er am Vormittag auf dem Marktplatz gesehen hatte.“
Während der persönliche Kontakt Cotognis mit Rossini auf diesen einen Besuch beschränkt blieb, stand er mit Verdi in dauernder Verbindung. Wie oft und wann er den großen Komponisten traf oder mit ihm zusammenarbeitete, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen; alles deutet jedoch darauf hin, daß dies sehr häufig geschah. Vielleicht kamen sie schon während der Proben zur Uraufführung des „Trovatore“ zusammen, die immerhin in Cotognis Heimatstadt Rom, ein Jahr nach dessen Debüt, stattfand. Sicher ist jedenfalls, daß sich die beiden im Jahre 1861 in Madrid kennenlernten, wo Cotogni in der dortigen Produktion von „La forza del destino“ – es war die erste Aufführung dieses Werkes nach der Urauffhürung in St. Petersburg – die Rolle des Don Carlo sang. Da Verdi, dem Brauch der Zeit gemäß, nicht nur anwesend war, sondern auch selbst die Proben leitete, ist es sicher, daß der junge Sänger diese Rolle in genauester Detailarbeit mit dem Komponisten einstudiert hat. Sicher ist auch, daß Cotogni bei den Proben zur Uraufführung des „Don Carlos“ in Paris anwesend war; da er zu diesem Zeitpunkt bereits dazu ausersehen war, die Partie des Posa bei der italienischen Erstaufführung des Werkes in Bologna zu singen, war er extra nach Frankreich gereist, um die Anweisungen, die Verdi dem dortigen Sänger gab, mit anzuhören.
Über eine der Zusammenkünfte zwischen Cotogni und Verdi sind wir allerdings sehr gut informiert, da sie Cotogni selbst in allen Einzelheiten oft erzählte. Es handelt sich dabei um seinen berühmten Besuch in Sant’Agata im Jahre 1867. Der Sänger war dorthin gefahren, um die letzte Absegnung des von ihm über alles verehrten Komponisten zu bekommen, bevor er nach Bologna fuhr, wo er unter der Leitung des berühmten Dirigenten und Verdi-Freunds Mariani zum ersten Mal die Rolle des Posa singen sollte.

Die Besetzung des “Don Carlo” in Bologna; ganz rechts Cotogni

Antonio Cotogni im Alter
Cotogni berichtet:
„Gegen Mittag kam ich bei der Villa an, und mir wurde mitgeteilt, daß der Maestro, der noch nicht da war, bald erwartet wurde. Er kam auch tatsächlich kurz danach an, in Bauerntracht und mit schlammbedeckten Kleidern. Als ich ihn in dieser Aufmachung sah, versuchte ich mich zu verstecken, um ihn nicht zu stören, aber er hatte mich bereits bemerkt und, ohne mir Zeit zu geben, ein einziges Wort zu sagen, reichte er mir die Hand und sagte: ‘Sie sind der Bariton Cotogni, nicht wahr? Ausgezeichnet; Mariani hat mir schon deswegen geschrieben, und ich habe das Vergnügen, Sie hier zu sehen und zu hören… Kommen Sie, Kommen Sie mit mir.’ Und ohne weitere Formalitäten führte er mich in sein Studio, nahm den Klavierauszug des „Don Carlo“ und sagte, auf dem Klavier präludierend: ‘Singen Sie doch die Auftrittsarie’. – Du kannst Dir nicht vorstellen, was ich in jenem Augenblick empfand! Ich war nicht mehr ich; trotzdem überwand ich mich und, wie Gott wollte, sang ich auch: ‘Carlo ch’è sol il nostro amore’.
Trotz der Bestürzung, die ich bei dieser höchsten Prüfung empfand, schaute ich in fieberhafter Erregung Verdi an, um zu sehen, welchen Eindruck er von meinem Singen hatte; und der Eindruck war gut, denn nach der Schlußkadenz rief er mir mit lauter Stimme „Bravo“ zu.
‘Jetzt hören wir das Duett an; ich werde den Part des Tenors singen’ sagte mir dann der Maestro.
Das Duett war meine Stärke, und es machte mir keine Sorge – außer an einer Stelle, die ich anders sang, als es der Komponist wollte. Ich sang sie jedoch, wie ich sie fühlte, auch unter der Gefahr, eine Rüge zu provozieren. Verdi hörte tatsächlich zu spielen auf, sah mich an und sagte:
‘Sie führen das nicht so aus, wie ich es geschrieben habe … aber das ist nicht so wichtig … singen Sie doch so; es geht gut – nein, vielleicht geht’s sogar besser so … das crescendo macht hier einen guten Effekt … und jetzt, um zum Schluß zu kommen, singen Sie Posas Tod.’
Das war genau das, was ich wünschte, und, nachdem ich mich von meinem Schreck erholt hatte, begann ich die Arie ‘Per me giunto è il dì supremo’, die ich so sang, wie ich sie vielleicht nie wieder in meinem Leben je gesungen habe. Ich sang mit dem ganzen Ungestüm meiner Seele und fühlte dabei, wie mir vor lauter innerer Bewegung die Tränen über das Gesicht rannen! Ich hörte erschöpft auf, aber eine unsägliche Freude erfüllte wie eine Woge mein Herz, da ich sah, daß auch der Maestro weinte!…
‘Bravo, mein kleiner Bescheidener!’ sagte er, indem er mir kräftig die Hand drückte. ‘Bravo!’ Fahren Sie nach Bologna und sagen Sie Mariani, daß Sie mich durch ihren Gesang zum Weinen gebracht haben!’
Ich fuhr voller Zufriedenheit nach Bologna zurück und sah der Premiere des „Don Carlo“ mit der größten Ruhe entgegen. Nachdem ich Verdi persönlich vorgesungen hatte, konnte mich das Publikum des Teatro Communale wahrhaftig nicht beunruhigen.“
Cotogni war nicht nur durch solche unmittelbaren Begegnungen, sondern auch durch seine langjährige Zusammenarbeit mit den größten Sängern der Donizetti-Bellini-Verdi-Zeit in den Besitz einer Erfahrung von unschätzbarem Wert gekommen – einer Erfahrung, die ihn zu der Aufgabe, Träger der authentischen Tradition zu sein, geradezu vorausbestimmte. Damit aber der Träger auch zum Vermittler werden konnte, mußte noch etwas dazukommen, nämlich ein ernsthafter und bescheidener Charakter. Denn nur wer bereit ist, die eigene Person zugunsten des objektiven Wissens hintanzustellen, ist imstande, dieses Wissen rein weiterzugeben. Daß Cotogni in höchstem Grade einen solchen Charakter besaß, geht schon aus seiner Erzählung über seinen Besuch in Sant’Agata deutlich hervor, wird aber außerdem durch zahlreiche Zeugnisse bestätigt. Verdi pflegte ihn „il mio ignorantino“ zu nennen, was ungefähr mit „mein kleiner Bescheidener, der du dein eigenes Licht immer unter den Scheffel stellst“ zu übersetzen wäre. Cotogni selbst sagte immer wieder: „Ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht mehr als die anderen.“ Sehr aufschlußreich ist das, was Battistini, der bei ihm den Don Giovanni studierte – also jene Partie, die Cotogni bei Tamburini gelernt hatte – über die gemeinsame Arbeit berichtete:
„Acht Tage lang studierte ich jene Oper unter seiner Führung, und er hielt keine Feinheit, keine Nuance vor mir geheim Er entschleierte mir alle die Geheimnisse seiner eigenen Kunst, ohne je sich ihrer zu rühmen; vielmehr sagte er gerade bei jenen Stellen, wo er sich als den größten Künstler offenbarte: ‘Queste sono le tradizioni e a queste dobbiamo attenderci’ (Diese sind die Traditionen, und an diese müssen wir uns halten), während er eigentlich hätte sagen sollen: ‘Dieses ist die Frucht meines langen Studiums und meiner großen Erfahrung.’“
Es war ein großes Glück für die Opernwelt, daß sich Cotogni, nachdem er seine Sängerlaufbahn beendet hatte, nicht ganz aus dem öffentlichen Leben zurückzog, sondern Pädagoge wurde. Hatte er schon während seiner aktiven Karriere Sängern wie Battistini oder Jean de Reszke bei der Ausarbeitung ihrer Rollen geholfen, so begann er nun, auf breiter Basis Gesangsunterricht zu erteilen.
Um die Jahrhundertwende wurde ihm eine Professur für Gesang an der Accademia di Santa Cecilia in Rom anvertraut; aus seiner Schule, die auch als die „römische Schule“ oder die „Cotogni-Schule“ berühmt wurde, gingen einige der bedeutendsten Sänger des 20. Jahrhunderts hervor, wie z.B. Beniamino Gigli, Giacomo Lauri-Volpi, Enrico Nani, Giuseppe de Luca oder Mariano Stabile, um nur die berühmtesten zu nennen.

Ricci mit Gigli

Ricci mit Mascagni
Über Cotognis Unterricht stand weiterhin als Motto: „Queste sono le traditioni e a queste dobbiamo attenderci“. Denn im Gegensatz zu heute bestand damals der Unterricht eines Gesangslehrers, zumindest wenn es sich um eine so überragende künstlerische Persönlichkeit wie Cotogni handelte, nicht nur aus technischer Schulung, sondern auch aus Unterweisung in Stil und Interpretation. Und gerade hier hatte Cotogni Einzigartiges zu bieten. „Schaut“, pflegte er seinen Schülern zu sagen, „hier erlaubte mir Rossini, eine kleine Kadenz einzufügen“ oder: „Hier sagte mir Verdi, daß man nicht zornig, sondern mit wehmütiger Empfindung singen sollte“ oder: „Hier schaltete Ronconi, der diese Partie mit Donizetti selbst einstudierte, eine kleine Atempause ein, damit er die nächste Phrase forte beginnen konnte…“
So sah der Unterricht aus, den die jungen Sänger damals bei Cotogni genossen. Zu den aufmerksamsten Zuhörern bei solchen Unterweisungen gehörte aber seit dem Jahr 1905 auch ein Pianist, der als Klavierbegleiter bei Cotogni angestellt war: Luigi Ricci.
Ricci, der im Jahre 1893 in Rom geboren wurde, war Sohn eines Kirchensängers und hatte schon seit seiner frühen Kindheit Klavier gespielt; oft genug hatte er auch als kleines Kind seinen Vater in der Kirche begleitet. Er war also nicht ganz ohne musikalische Vorbildung, als er im Alter von nur zwölf Jahren zu Cotogni kam und von diesem als Pianist engagiert wurde.
Mit diesem Engagement begann eine Zusammenarbeit, die Riccis ganzem Leben die Richtung weisen sollte. Dreizehn Jahre lang, von 1905 bis 1918, begleitete er die Gesangsstunden Cotognis – nicht nur bei ihm zuhause, sondern seit 1907 auch an der Accademia di Santa Cecilia.
„Mit dieser Arbeit“, schrieb er später, „begann meine Tätigkeit – nicht als Sänger, sondern als Gesangslehrer und Opernrepetitor; und von Cotogni lernte ich die Methode, die es ihm ermöglichte, eine Schar von Belcanto-Sängern hervorzubringen, die nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt noch Italien größte Ehre bringt.“
Es war aber nicht nur die Unterrichtsmethode, die Ricci von Cotogni lernte. Während er die Stunden des großen, alten Sängers begleitete, hatte er auch Gelegenheit, dessen enormes Wissen in sich aufzunehmen. Und wenn Cotogni seinen Schülern erzählte, was ihm Rossini oder Verdi gesagt, oder wie dieser oder jener berühmte Sänger der Belcanto-Epoche ein bestimmtes Stück oder eine bestimmte Phrase gestaltet hatte, hörte Ricci nicht nur mit größter Aufmerksamkeit und voller Ehrfurcht zu, sondern schrieb gewissenhaft jedes Wort, das er vernommen hatte, in seinen eigenen Klavierauszügen oder Partituren auf. Auf diese Weise ging der ganze Erfahrungsschatz, den sich Cotogni im Laufe eines langen Lebens gesammelt hatte, in den Besitz Riccis über und wurde so für die Nachwelt erhalten.
Riccis eigenes Leben stand ganz im Dienste dieser authentischen Überlieferung; auch über seinem Wirken stand als Motto der Ausspruch Cotognis: „Queste sono le tradizioni e a queste dobbiamo attenderci“. Bald sollte Ricci auch Gelegenheit finden, diese Traditionen an andere weiterzugeben. Noch während seiner Lehrzei bei Cotogni wurde er als Pianist am Teatro Costanzi (dem späteren Teatro all’Opera) in Rom engagiert, wo er mit vielen der bedeutendsten Sängern der Epoche arbeiten konnte. Wiederholte Tournées nach Südamerika, die teilweise unter Leitung Mascagnis standen, brachten ihn mit weiteren berühmten Künstlern zusammen. Von 1928 bis 1934 war er an der Scala tätig; als aber Tullio Serafin nach Rom ging, um die Leitung des dortigen Opernhauses zu übernehmen, folgte ihm Ricci dorthin, wo er zum wichtigsten Mitarbeiter des großen Dirigenten wurde, der ihm alles, was mit Einstudierung von Gesangspartien zu tun hatte, im vollsten Vertrauen überließ.
Im Verlaufe einer 60-jährigen künstlerischen Tätigkeit arbeitete Ricci mit so gut wie allen Sängern, die in der italienischen Oper Rang und Namen hatten. Mit Gigli verband ihn schon seit der gemeinsamen Zeit bei Cotogni eine enge Freundschaft.
„Sein Repertoire“, -schreibt Ricci – „in dem er wahrhaft triumphale Erfolge gefeiert hat, hat er mit mir einstudiert (…) Ich habe mit ihm Konzerttournées in 40 Städten gemacht.“
Die Namen aller anderen Sänger, die bei ihm ihre Rollen einstudierten oder bei ihm Unterricht nahmen, würden mehrere Seiten füllen. Neben den Cotogni-Schülern Giuseppe de Luca, Giacomo Lauri-Volpi, Mariano Stabile und Enrico Nani seien hier, um einen Eindruck von der Breitenwirkung, die Ricci durch seine Tätigkeit erreichen konnte, noch Claudia Muzio, Tuta Ruffo, Rosina Storchio, Gilda dalla Rizza, Maria Caniglia, Elvira de Hidalgo, Michele Fleta, Ferruccio Tagliavini, Apollo Granforte, Aureliano Pertile und Fjodor Schaljapin genannt. In neuerer Zeit gehörten Leontyne Price und Anna Moffo zu seinen berühmtesten Schülern – sowie Toti Gobbi, der, wie Gigli, alle seine Rollen bei Ricci einstudierte und diesem auch seine ganze Interpretationskunst verdankte.
Ricci, der nur selten dirigierte und keinen Ehrgeiz auf diesem Feld hatte, erlangte mit der Zeit auf dem Gebiet der Sänger-Einstudierung eine absolute Sonderstellung. Lauri-Volpi erzählt in seinem Buch „L’equivovo“:
„An der Scala fand ich Maestro Luigi Ricci engagiert, der vorher Korrepetitor bei Emma Carelli am Teatro Costanzi in Rom gewesen war. Vor dem Krieg hatte ich ihn als Klavierbegleiter in der Klasse Antonio Cotognis an der Santa Cecilia kennengelernt. Bei Gelegenheit meines Auftritts in der Arena zu Verona hatte ich Zenatello gebeten, ihn zu engagieren. Zenatello war mit ihm zufrieden, so wie Scandiani, an der Scala, von ihm begeistert war. Ricci wurde von diesem Zeitpunkt an eine Zelebrität auf dem Gebiet der Korrepetitoren…“
In einem Artikel über Ricci, der im Jahre 1974 in der „Opera news“ erschien, wird er wie selbstverständlich „Italy’s greatest coach“ genannt.
Bei Riccis Arbeit mit den Sängern stand die Ehrfurcht vor dem Willen der großen Komponisten an erster Stelle. „Es ist bekannt“ – schrieb er einmal – „daß die Meister willkürliche Interpretationen ihrer Musik durch Sänger, die kein anderes Ziel haben, als bei der Galerie Erfolg zu haben, nicht lieben. Man hat gesehen, daß weder Rossini noch Verdi solche Übergriffe liebten; dasselbe gilt auch für Puccini.“ Andererseits wußte er besser, als jeder andere, daß Werktreue nicht unbedingt Notentreue bedeutet, und wenn er in seinem Unterricht versuchte, den Sänger zu einer Interpretation hinzuführen, die sich mit den Absichten des Autors deckte, so gehörten alle jene unschätzbaren Informationen dazu, die er als mündliche Überlieferung von Cotogni bekommen hatte.
Die Cotogni-Tradition bildete jedoch nicht die einzige Grundlage von Riccis Arbeit. Denn sobald er seine eigene Theaterlaufbahn begann, bekam er Gelegenheit, den Schatz an authentischer Überlieferung durch eigene Erfahrungen selbst zu vermehren. Schon als Fünfzehnjähriger konnte er Mascagni bei der Einstudierung einer seiner Opern in Rom beobachten. Der Bericht, den er hierüber verfaßte – es handelte sich um die Erstaufführung von „Le Maschere“ im Jahre 1908 -, ist vor allem deshalb interessant, weil er uns einen Einblick in die lebendige Probenarbeit eines Komponisten gibt, der mit größter Genauigkeit sein Werk mit den Sängern selbst einstudiert. Hier können wir unmittelbar die Entstehung dessen erleben, was wir als authentische Tradtion bezeichnen:
„Um mich auf das Zuhören vorzubereiten, hatte ich aus der Leihbibliothek von Emanuele Grandi, einem Musikhändler, den Klavierauszug ausgeliehen. Es sei noch nebenbei erwähnt, daß ich diesen Auszug nach der Aufführung von „Le Maschere“ auch käuflich erwarb, damit ich dort die Korrekturen, die Sprünge und die Ergänzungen eintragen konnte, die der Autor später anbrachte. Ich bewahre ihn jetzt als eines meiner kostbarsten Erinnerungsstücke auf (…)
Ich befand mich in einer Ecke mit meinem Klavierauszug in der Hand. Als Mascagni hereinkam, gingen ihm alle entgegen. Nachdem er alle mit großer Freundlichkeit begrüßt hatte, fing die Probe sofort an. Es war das erste Mal, daß ich Mascagni sah, und für mich war es eine Offenbarung. Ich verstand auf einmal, was es hieß, eine Oper einzustudieren. Mascagni kümmerte sich um jede Einzelheit; d.h., er war einer jener Animatoren, die imstande sind, den eigenen Enthusiamus und die eigene Leidenschaft auch anderen einzuflößen. Einerseits schien es, als ob er sich nur um die Musik kümmerte; andererseits aber, zwischen einer witzigen Bemerkung und der anderen, belehrte er die Sänger, indem er sie fortwährend unterbrach, um ihnen zu zeigen, wie sie diese oder jene Phrase zu singen hatten. Die Sänger folgten ihm mit lebhaftem Interesse und Gewinn. Nachdem er mit seiner nasalen Stimme den Charakter einer jeden Person bezeichnet hatte, legte er ihnen seine, wie man heute sagen würde, Regie-Ideen dar, die er nicht nur erklärte, sondern durch praktische Beispiele deutlich machte. Er imitierte z.B. die Bewegungen, die Pirouetten, das Kopfschütteln, den Gruß des Arlecchino, zeigte dem Pantalone das charakteristische Heben des Mantels, die Art, in der er sich den Bart streicheln sollte, sowie die ernste und schwerfällige Haltung, die diese Figur haben mußte; und dem Capitano Spavento führte er das hochmütige, an Cyrano erinnernde Einherschreiten vor. Einen besonderen Eindruck machte mir die Art, wie er dem Tartaglia das stotternde Singen beibrachte und der Rosaura zeigte, wie sie in die Arme des Florindo zu fallen hatte.
Dann ging er wieder ans Klavier; und das, was er durch Worte und Gesten erklärt hatte, sang und rezitierte er nun, immer wieder von vorne beginnend…“
War Ricci bei der Probenarbeit zu „Le Maschere“ nur ein unbeteiligter Zuhörer gewesen, so durfte er sich einige Jahre später schon als aktiver Mitarbeiter an einer Mascagni-Uraufführung beteiligen, und zwar bei der Premiere von „Lodoletta“, die 1917 in Rom stattfand. Das war der Beginn einer jahrelangen Zusammenarbeit mit Mascagni – und auch einer persönlichen Freundschaft, die bis zum Tod des großen veristischen Komponisten dauern sollte. Mascagni war jedoch nicht der einzige Komponist, mit dem Ricci eine persönliche Verbindung hatte. Auch mit Leoncavallo und Giordano arbeitete er zusammen; und auch hier hatte er Gelegenheit, die mündlichen Anweisungen, die die Komponisten selbst während der Einstudierung ihrer Werke gaben, aufzuzeichnen und für die Nachwelt zu erhalten.
Die wichtigste künstlerische Begegnung jedoch, die Ricci im Laufe seiner langen Wirksamkeit zuteil wurde, war ohne Zweifel die mit Puccini. Acht Jahre lang begleitete er alle Proben, die dieser anläßlich der Einstudierung seiner eigenen Werke in Rom leitete. Dadurch gelangte Ricci in den Besitzt eines Wissens von unschätzbarem Wert. Denn auch Puccini war gewohnt, minutiös mit den Sängern an der Interpretation ihrer Rollen zu arbeiten; auch er wollte genau und ohne Abstrich seinen Willen ausgeführt sehen und konnte eine Viertelstunde lang einen berühmten Sänger unbarmherzig traktieren, bis dieser ein portamento oder ein dimenuendo genauso sang, wie er, Puccini, es haben wollte. Das meiste davon stand nicht in der Partitur; wie er selbst zu sagen pflegte: „Tutto non si può scrivere“ („Man kann nicht alles aufschreiben“). So entstand von neuem eine wichtige mündliche Tradition, die von Ricci wieder mit größter Gewissenhaftigkeit – er kontrollierte mit dem Metronom sogar die Tempi, die Puccini während der Proben nahm – registriert und schriftlich fixiert wurde. Als Frucht dieser Arbeit entstand das Buch „Puccini interprete di se stesso“, das nicht nur allgemeine Bemerkungen über den Stil enthält, sondern auch Takt für Takt alle jene Änderungen und Ergänzungen wiedergibt, die Puccini während der Probenarbeit verlangt hatte.
Dies alles weiterzugeben, empfand Ricci als seine Lebensaufgabe. Bis zu seinem Tod im Jahre 1981 war er in diesem Sinne auch unermüdlich tätig. Noch Ende der Siebzigerjahre, da er schon weit über 80 war, unterrichtete er acht Stunden am Tag. In seinen letzten Jahren kamen nicht nur Sänger aus allen Erdteilen zu ihm, sondern auch Dirigenten, denen es noch daran gelegen war, die „echten Traditionen“ zu erfahren. Carlo Maria Giulini suchte ihn z.B. auf, um mit ihm über die Interpretation des „Don Carlo“ zu sprechen – doch nicht, wie Ricci später immer wieder betonte, um seine Meinung zu hören, sondern um zu erfahren, „was Verdi selbst gewollt hatte“. Auch Erich Leinsdorf hatte keinerlei Bedenken, sich an Ricci in Fragen der Interpretation und des Stils zu wenden. Da der berühmte Dirigent mit Leontyne Price in Rom „Tosca“ aufnahm, bat er Ricci, zu den Sitzungen ins Studio dazu zu kommen. „Sie stellen sich neben ihre Schülerin“ sagte er zu ihm „und dirigieren sie, wie Sie es für richtig befinden; sie soll Ihnen folgen, und ich folge dann ihr.“ Es gibt sogar ein Foto, das während der Aufnahme gemacht wurde, und auf dem diese Gruppierung genau zu sehen ist.
Erst ein Jahr vor seinem Tod mußte Ricci, der schon lange an einer Herzkrankheit gelitten hatte, notgedrungen das Unterrichten aufgeben. Er hörte jedoch keineswegs mit der Arbeit auf; in Rocca di Papa, einem schön gelegenen kleinen Ort am Albanersee, wo er sich eine kleine Wohnung gekauft hatte, widmete er sich dem Schreiben und vollendete mehrere Aufsätze und Bücher: eine große Selbstbiographie, kleinere Hefte mit Erinnerungen an Cotogni und Gigli, eine Schrift mit detaillierten Anweisungen zur Interpretation der Trias „Rigoletto“ – „Trovatore“ – „Traviata“, sowie Monographien über Mascagni, Leoncavallo und Giordano als Interpreten ihrer eigenen Werke. Diese Schriften, die nur als Manuskript existierten, sind nach seinem Tod mit höchster Wahrscheinlichkeit verloren gegangen. Seine Notenbibliothek brachte er dagegen schon vor seiner Übersiedlung nach Rocca di Papa in Sicherheit, indem er sie einer seiner ehemaligen Schülerinnen verkaufte. Jane Klaviter, die als Korrepetitorin und Souffleuse an der Metropolitan Opera in New York arbeitet, ist jetzt im Besitz dieses kostbaren Materials, das im Falle ihres Ablebens einer amerikanischen Universitätsbibliothek übergeben werden soll.
Daß der Name dieses Mannes, der 60 Jahre lang wie kein anderer den Stil der italienischen Oper prägte, in keinem Musiklexikon steht, ist nicht nur unverständlich, sondern geradezu skandalös. Doch es ist vielleicht auch ein Zeugnis dafür, daß er in hohem Grade jene zwei Charaktereigenschaften besaß, die man haben muß, um eine Tradition rein weiterzugeben: Objektivität und Bescheidenheit. Ricci gehörte zu jenen ganz seltenen ausübenden Künstlern, die, obwohl sie selbst bedeutende Persönlichkeiten sind, ihre Lebensaufgabe im Dienen erblicken und deshalb bereit sind, aus Ehrfurcht vor den großen schöpferischen Genies die eigene Person ganz in den Hintergrund treten zu lassen.
Ich selbst hatte das unschätzbare Glück, Schüler von Ricci zu sein.
Ich lernte ihn im Jahre 1971 kennen. Ich war damals Dirigent an der Finnischen Nationaloper in Helsinki und sollte eine Wiederaufnahme von Verdis „Don Carlo“ dirigieren. Der damals noch blutjunge Matti Salminen war als Philipp vorgesehen; er war kurz vorher in Rom gewesen und hatte seine Rolle mit Ricci durchgenommen. Der Sänger des Posa, Jorma Hynninen, hatte früher auch schon mit Ricci gearbeitet und wollte noch einmal zu ihm hinfahren, um diese Partie, die für ihn ganz neu war, mit ihm einzustudieren. Er riet mir dringend, mitzufahren, um den einzigartigen Maestro, der angeblich alle „Traditionen“ wußte, und von dem er nur in den höchsten Tönen des Lobes sprechen konnte, kennenzulernen. Ich war zunächst skeptisch; denn einerseits hatte ich alle die typischen Vorurteile des Nicht-Romanen gegen die italienische Oper, die ich, im Vergleich zu Mozart, Wagner und Strauss, für oberflächlich und plakativ hielt; andererseits wußte ich nichts von Riccis Vorgeschichte und meinte, er würde wahrscheinlich nur die schlechten Gewohnheiten, die man schon von vielen italienischen Sängern her kannte, als „Tradition“ verkaufen. Hynninen blieb jedoch hartnäckig und es gelang ihm schließlich – zu meinem Glück – mich zu überreden. Also fuhr ich mit nach Rom, um der Einstudierung der Rolle des Posa als passiver Zuhörer beizuwohnen.
In den zwei Wochen, die ich in der italienischen Hauptstadt verbrachte, eröffnete sich mir eine völlig neue Welt. Ich kann mich gut erinnern, wie ich das Studio Riccis in der via Amendola – ein Zimmer, das mir in den Jahren danach so vertraut werden sollte – zum ersten Mal betrat. Es war ein relativ kleiner Raum. In einer Ecke stand Riccis Flügel; ihm gegenüber sah man ein altes, niedriges viereckiges Klavier, von dem ich später erfuhr, daß es einst Rossini gehört hatte. An einer Wand waren Regale befestigt, die vom Boden bis zur Decke reichten; darin befanden sich die Klavierauszüge, die Ricci bei seiner Arbeit brauchte. Alle anderen Wände waren mit Fotos bedeckt, die mit Widmungen von den berühmtesten Sängern und Dirigenten des Jahrhunderts versehen waren; unter diesen befand sich auch jenes bekannte Gruppenbild, das anläßlich der italienischen Erstaufführung des „Don Carlo“ in Bologna gemacht worden war, und das eine Originalwidmung Verdis an Cotogni trug. Der kleingewachsene Maestro selbst – er reichte mir ungefähr bis zur Schulter, hatte aber eine eindrucksvolle römische Adlernase – strahlte mit seiner Ernsthaftigkeit und Ruhe eine Autorität aus, die mich sofort in ihren Bann zog.
Die Rolle des Posa beginnt mit einem kurzen Ausruf: „È lui!… desso… l’Infante!“ („Er ist es… er selbst… der Infant!“) Es handelt sich dabei um eine fast gesprochene Phrase, die dem Sänger rein musikalisch keinerlei Schwierigkeiten bietet. Jeder gewöhnlich Korrepetitor hätte sich damit begnügt, diese paar Noten rhythmisch korrekt einzustudieren, um dann zu der „richtigen“ Musik des Duetts überzugehen. Nicht so Ricci: Er unterbrach schon nach diesen ersten zwei Takten und begann, mit großem Ernst und innerer Beteiligung, die ganze Vorgeschichte dieser Szene zu erzählen. Er sprach von der schwärmerischen Freundschaft, die Posa und Carlos in ihrer Jugend verbunden hatte, und schilderte die heiligen Schwüre, durch die die Freunde ihre Absicht besiegelt hatten, zusammen eine neue, menschlichere und freiere Welt zu schaffen. Er erzählte dann, wie Posa, der jahrelang von Spanien fern gewesen, jetzt aber zurückgekehrt sei, mit fieberhafter Erregung dem ersten Wiedersehen mit seinem Freund entgegensehe. Und dann versuchte er das Gefühl überbordender, enthusiastischer Freude zu beschreiben, die in jenem sonst so belanglos erscheinenden Satz „È lui!… desso… l’Infante!“ zum Ausdruck kommt. „So“, sagte er dann, „jetzt singen Sie die Phrase noch einmal – mit Ausdruck.“
Das alles war für mich eine Offenbarung. Ich hatte nie erlebt, daß jemand auf diese Art und Weise arbeitete; denn der Korrepetitor sieht seine Aufgabe normalerweise darin, den Orchesterpart am Klavier zu spielen und zu kontrollieren, daß der Sänger die richtigen Noten singt. Hier hatte ich dagegen einen meisterhaften Lehrer für Stil und Interpretation vor mir, der ein immenses Wissen besaß, das Werk von innen heraus genauestens kannte und, auf dieser Grundlage arbeitend, dem Sänger zu einer geschlossenen Rollengestaltung verhelfen wollte, bei der das Musikalische, das Stimmliche, das Psychologische und das Dramatische ineinander greifen sollten, um eine wirkliche Einheit entstehen zu lassen. Und in dieser Einheit war alles – auch das kleinste, scheinbar belanglose Detail – wichtig.
Erst nachdem der Sänger diese zwei Takte zufriedenstellend gesungen hatte, ging Ricci weiter. Bald kam jene Stelle, die Cotogni, da er die Rolle mit Verdi durchgemacht hatte, anders gesungen hatte, als sie in der Partitur stand. Es handelte sich dabei um die Phrase „Carlo mio, con me dividi il tuo pianto, il tuo dolor!“ („Mein Carlos! teile mit mir deine Tränen und deinen Schmerz!“), die mit einem hohen „Fis“ auf dem Wort „tuo“ ihren Höhepunkt erreicht. Verdi hatte auf diesem „Fis“ ursprünglich ein dolcissimo pp vorgeschrieben. Nun wäre es für Cotogni überhaupt nicht schwer gewesen, dieses pianissimo zu singen; im Gegenteil, das „fior di labbra“ – also die zarte, „blumenhafte“ Stimmgebung – war sogar eine Spezialität von ihm. Doch er empfand die Phrase einfach anders: Das pianissimo schien ihm an dieser Stelle gekünstelt zu sein; sollte er das Gefühl überschäumender Freundschaft, das hier geradezu wie eine Explosion aus Posa hervorbricht, mit echter Empfindung singen, dann mußte er – so fühlte er deutlich – ein crescendo machen, das in einem fortissimo auf dem hohen Ton endete.
Als Hynninen diese Stelle sang, unterbrach Ricci natürlich sofort. „Guardi“ – sagte er – „qui Cotogni mi diceva che Verdi gli aveva detto…“ („Hier erzählte mir Cotogni, daß Verdi ihm gesagt hatte…“) – und erzählte darauf die ganze Geschichte von Cotognis Besuch in Sant’Agata, und daß der große Verdi es dem jungen Sänger erlaubt habe, diese Phrase so zu singen, wie er es fühlte – ja, daß er sogar dafür gesorgt habe, daß die Dynamik, die Cotogni als unecht empfunden hatte, bei der nächsten Ausgabe des Werkes aus der Partitur gestrichen würde, so daß es dem heutigen Interpreten nach gutem Belcanto-Brauch nunmehr freistehe, die Stelle so zu bringen, wie er sie am richtigsten findet. Cotognis Vorsingen bei Verdi hatte im Jahre 1867 stattgefunden; Ricci hatte die Geschichte vielleicht im Jahre 1905 gehört; und wir schrieben damals das Jahr 1971. Trotzdem erzählte Ricci das alles so, als ob es sich gestern ereignet hätte. Man hatte das Gefühl, als ob Verdi selbst im Zimmer gegenwärtig wäre…
Dann kam das berühmte Duett „Dio che nell’alma infondere amor volesti e speme…“ („Gott, der du unserer Seele Liebe und Hoffnung einflößen wolltest…“). Hynninen – der übrigens ein Sänger von besonderer Intelligenz und Feinfühligkeit war – hatte mit Absicht darauf verzichtet, sich vor dem Unterricht bei Ricci eine eigene Interpretation zurechtzulegen; denn er wollte das Wissen, das dieser ihm vermitteln sollte, ohne vorgefaßte Meinung aufnehmen. Deshalb sang er den Anfang dieses Duettes in einem gewöhnlichen mezzoforte, wie man es auch auf den meisten Schallplattenaufnahmen gesungen hört. Hier unterbrach Ricci fast heftig. „Ma no!“ rief er aus, „è una preghiera! („Es ist ein Gebet!“) – piano! piano!“ Nach dieser Belehrung sang es Hynninen noch einmal, jetzt aber in einem wunderbaren, zarten piano. Dadurch war die ganze Musik auf einmal völlig verwandelt; und mir wurde klar, daß der richtige, authentische Verdi-Stil etwas ganz anderes war als jene äußerliche Zurschaustellung oft geheuchelter Emotionen und jenes pausenlose forte-Singen, die man leider oft genug auch von den berühmtesten italienischen Sängern zu hören bekommt. Hier war alles dramatisch wahr, von echtem Gefühl getragen und auch dynamisch differenziert. Verdis Musik gewann dabei einen Adel, der ihr einen völlig neuen Wert verlieh.
Danach folgte ein Schlüsselerlebnis dem anderen. Am Anfang der Arie „Carlo ch’è sol il nostro amore“ wird, dem Belcanto-Brauch gemäß, die erste Phrase durch ein portamento mit der darauffolgenden verbunden. Nun kann man ein portamento auf sehr verschiedene Art und Weise ausführen. Macht man dabei z.B. ein großes vibrato, ohne daß dieses durch eine starke, extravertierte Emotion gerechtfertigt ist, dann kann das portamento leicht aufgesetzt und plakativ wirken. In dieser verhaltenen Arie wäre ein solches vibrato auf jeden Fall fehl am Platz. Deshalb verlangte Ricci, daß der Sänger ein leichtes portmento mit dimenuendo und ohne allzu großes vibrato mache – und selbstverständlich ohne danach zu atmen. „Il portamento“ – erklärte er – „deve legare le due frasi, portare l’una all’altra!“ („Das portamento muß die beiden Phrasen miteinander verbinden, die eine zur anderen hintragen!“). Und dann sang er selbst ein portamento von einer Eleganz vor, wie ich sie bis dahin noch nie gehört hatte. Es war, als ob die Phrase, wie durch die eigene Schwerkraft getrieben, ganz sanft aus der Höhe heruntersinken würde, um nachher die Bewegung auf natürlichste Art und Weise fortzusetzen. Auch hier also keine Äußerlichkeiten und keine Effekthascherei, sondern feinste, nobelste Phrasierungskunst, die wie selbstverständlich aus der psychologisch-dramatischen Situation hervorging.
So ging es dann von Stunde zu Stunde weiter; es kam eine Offenbarung nach der anderen. Am schönsten war wohl die Schlußarie – jene Szene, bei der Cotogni Verdi zum Weinen gebracht hatte. Ricci erklärte hier Hunderte von Einzelheiten, die entweder gar nicht in der Partitur stehen oder – falls sie Verdi aufgeschrieben hat – sehr selten richtig ausgeführt werden: dynamische Nuancen, Phrasierungen, Akzente, portamenti, rubati, Fermaten, kleine Temporückungen usw. Dabei betonte er bei jeder neuen Belehrung immer wieder, daß dies alles nicht von ihm stammte; „Così fece Cotogni“ sagte er, „quando cantava per Verdi“ (So machte es Cotogni, als er diese Stelle Verdi vorsang“). Was dabei herauskam war eine Interpretation von höchster Einfachheit und nobelster Verhaltenheit. Der ganze erste Teil – das berühmte „Per me giunto è il di supremo“ – ließ Ricci in einem durchgehenden piano singen, das sich an den ausdrucksvolleren Stellen höchstens bis zu einem mezzopiano dolce steigern durfte; auch das hohe „F“ am Ende durfte nicht lauter gesungen werden. Alles, auch die Tempo-Rückungen, durch die diese Musik ihr inneres Leben empfängt, mußte, der Situation entsprechend, maßvoll und edel sein. Vor allem war aber alles wahr. Keine Dynamik, keine Phrasierung, keine Tempo-Änderung durfte gemacht werden, die nicht psychologisch und dramatisch motiviert war. Man meinte fast, ein Stück von Mozart zu hören.
In der Folgezeit benutzte ich jede Gelegenheit, um nach Rom zu fahren, damit ich mir möglichste viel von diesem unschätzbaren Wissen aneignen konnte. Auf diese Weise konnte ich, wenn nicht alles, so doch einen großen Teil des italienischen Repertoires mit Ricci durchmachen. Meistens war ich mit ihm allein. Dann saß ich am Klavier und spielte, er saß neben mir, sang und dirigierte – und unterbrach dann, um mir etwas Musikalisches zu erklären oder manchmal auch, um eine bestimmte Stelle szenisch vorzumachen. Dabei sagte er immer wieder: „Guardi: qui Cotogni mi diceva che Verdi gli aveva detto…“ Manchmal durfte ich auch dabei sein, wenn er mit Sängern arbeitete – was oft interessanter als die Einzelstunden war, da er dann die Psychologie der Figuren genauer erklärte und auch an der technischen Ausführung der verschiedenen Ausdrucksmittel feilte. Als besonders schön habe ich die Arbeit an „Rigoletto“ in Erinnerung, der durch wahren Gefühlsausdruck und zarte dynamische Nuancen jede Spur von „Drehorgelhaftigkeit“ verlor und zu einem noblen und ergreifenden Musikdrama wurde. Auch die Arbeit an der “Boheme“ war besonders interessant. Hier hatte Ricci alles unmittelbar aus erster Hand und konnte mir besonders viel über die psychologische Rollengestaltung, wie sie Puccini erklärt hatte, erzählen.
Oft kamen sehr überraschende Tatsachen zum Vorschein. So hatte Cotogni z.B. seinen Schülern erzählt, daß man in seiner Jugend, also um 1850 herum, das letzte allegro des I. Finales des „Barbiere di Siviglia“: „mi par d’esser con la testa in un’orrida fucina“ – ein Stück, das heutzutage in einem rasanten alla breve genommen wird – noch „auf vier“ dirigiert hatte. Ein so langsames Tempo wäre heute völlig unvorstellbar, aber es erklärt, warum Rossini im Mittelteil Triolen für die Gesangsstimmen schrieb (diese werden, da sie im schnellen Tempo singbar sind, bei heutigen Aufführungen meist in einfache Achtelnoten umgeändert). Ricci machte mich auch auf einen anderen Brauch aufmerksam, der heute völlig in Vergessenheit geraten ist, nämlich die zu Cotognis Jugendzeit verbreitete Gewohnheit, bei den wiederholten Schlußkadenzfloskeln, mit denen in den meisten Arien und Ensembles von Rossini und Donizetti der gesungene Teil abgeschlossen wird, die letzte von dieser Floskeln plötzlich doppelt so langsam wie die vorhergehenden zu nehmen.
Manchmal wurden auch weit verbreitete Vorurteile als Irrtümer entlarvt – so z.B. die besonders bei nordischen Puristen weit verbreitete Meinung, man dürfe in der ersten Arie der Mimi bei den Worten : „ma quando vien lo sgelo“ kein portamento machen, da dieses nicht in der Partitur stehe. In Wirklichkeit ist die Sache genau umgekehrt: Puccini selbst verlangte an dieser Stelle immer ein portamento – und zwar eines, daß ohne Atem in die neue Phrase hinüberleitet. Er erklärte auch den Grund dafür: Mimi, die eben mit leiser Selbstironie von sich gesprochen hat, wird an dieser Stelle plötzlich von einer starken erotischen Erregung erfaßt; und dieser Übergang sollte eben durch das portamento zum Ausdruck kommen. „Cambiando da ridendo in sensuale“ („vom Lachen ins Sinnliche übergehend“) sind die Worte, mit denen Puccini selbst diese Gefühlsveränderung, die während dieses einen Tons zu geschehen habe, beschrieb – ein unbeschreiblicher Effekt, den die meisten Sänger sich entgehen lassen, weil das portamento eben „nicht in den Noten steht“. Auch das gängige Vorurteil, daß die Toscanini-Aufnahme der „Boheme“ stilistisch mustergültig und nachahmenswert sei, wurde von Ricci korrigiert. Da Toscanini die Uraufführung des Werkes dirigiert hatte, meinen nämlich viele heutige Musiker und Musikfreunde, daß seine Platteneinspielung, obwohl sie mehr als ein halbes Jahrhundert nach jener Aufführung entstand, genau dem Willen des Komponisten entsprechen müsse. Auch ich dachte früher so – obwohl mein Gefühl dagegen starken Widerspruch erhob; denn Toscaninis musiziert bei dieser Aufnahme spröde, hart, ohne jeden sinnlichen Schmelz – und vor allem geradezu unsinnig schnell. Da ich Ricci, der viel mit Toscanini zusammengearbeitet hatte und diesen auch hoch verehrte, einmal vorsichtig fragte, was davon zu halten sei, antwortet er ohne Zögern: „È una porcheria“ („Das ist eine Schweinerei“) – ein hartes Urteil, das er jedoch gleich darauf begründete. „Mai Toscanini dirigeva così quando era giovane“ sagte er („Nie dirigierte Toscanini so, als er noch jung war“); und dann erklärte er, daß der große Dirigent, da er älter wurde, eine furchtbare Angst davor hatte, langsam und sentimental zu werden, und daß er, um dem entgegenzuwirken, in seinen letzten Lebensjahren mit Absicht das Gegenteil gemacht habe – wobei er wieder ins andere Extrem gefallen sei.
Riccis Unterricht war von unbedingter Ehrfurcht vor den großen Werken der Opernliteratur geprägt; er selbst trat völlig hinter diese Werke zurück. Daß jedoch Werktreue nicht mit Texttreue identisch war, wußte er, der erlebt hatte, wie selbst Komponisten des 20. Jahrhunderts während der Probenarbeit Änderungen und Ergänzungen an ihren eigenen Partituren verlangt hatten, besser als jeder andere. Deshalb bestand ein Großteil seines Unterrichts darin, all das mitzuteilen, was nicht in den gedruckten Noten steht, jedoch von den Komponisten selbst als zum Werk oder zum Stil gehörend betrachtet wurde. Die Authentizität von Riccis Mitteilungen wird durch die Ehrfurcht verbürgt, die er vor dem Komponisten empfand. Nie hätte er etwas geändert, wenn er nicht absolut sicher gewesen wäre, daß dies im Sinne des Werkschöpfers war. Ich kann mich gut erinnern, wie ein junger Tenor einmal bei der ersten Arie des Herzogs in „Rigoletto“ eine von Verdi nicht autorisierte Kadenz sang, die bis zum hohen „Des“ hinaufging. Ricci bekam einen veritablen Wutanfall, der Toscanini alle Ehre gemacht hätte. „Un’insulta contro Verdi!“ (Eine Beleidigung Verdis!“) schrie er immer wieder, und es dauerte lange, bis er sich beruhigt hatte und die Stunde fortsetzen konnte.
Die Interpretation, die unter seiner Leitung entstand, war im besten Sinne des Wortes modern. Sie war nicht nur durch Einfachheit und Echtheit, sondern auch durch psychologische und dramatische Wahrhaftigkeit gekennzeichnet; äußere Effekthascherei war ihr völlig fremd. Darüber hinaus war sie von einer musikalischen Logik, wie ich sie sonst nirgends, auch nicht bei den größten Dirigenten, erlebt habe – was für mich der größte Beweis dafür ist, daß sie nicht von Ricci, sondern von den Komponisten selbst stammte. Seine Stunden bestanden aus lauter Offenbarungen; wenn er etwas erklärte oder vormachte, so war die häufigste Reaktion: „Aha! Jetzt verstehe ich erst, warum der Komponist diese Stelle so geschrieben hat!“ Deshalb fühlte man sich auch nie dazu gezwungen, etwas bloß deswegen anzunehmen, weil die Tradition es so verlangte. Nicht weil Ricci sagte, daß es so sein müsse, übernahm man das, was er vorschlug, sondern weil man mit großer Sicherheit fühlte, daß es gar nicht anders sein konnte. So erlebte man Tradition als etwas, was nicht einengt, sondern befreit.
Wenn wir zum Schluß nach Riccis Verhältnis zum Belcanto fragen, so müssen wir zunächst feststellen, daß er während der dreizehn Jahre, die er bei Cotogni verbrachte, von diesem eine große Menge von authentischen Informationen über die Aufführungspraxis der Rossini-Bellini-Donizetti-Zeit bekommen hatte – Informationen, die nicht nur den Stil im allgemeinen, sondern auch viele Einzelheiten der Rolleninterpretation betrafen. Andererseits war Riccis eigene Einstellung stark durch Verdi und den verismo geprägt – durch zwei Stile also, die dem Komponisten und seiner Partiturniederschrift einen viel höheren Stellenwert einräumten und dem Sänger viel weniger Freiheit ließen, als dies im Belcanto-Stil der Fall gewesen war. Wenn man also irgendwo einen Unterschied zwischen Riccis Auffassung und der Auffassung der Belcanto-Komponisten selbst sehen will, so kann dieser Unterschied nur darin bestehen, daß jene strenger war als diese; und so kam es oft genug vor, daß Ricci an einer Stelle, wo ein heutiger Belcanto-Spezialist eine Kadenz oder eine Variation anbringen würde, den Sänger „come scritto“ – also wie geschrieben – singen ließ. Gerade diese Strenge bietet aber die Gewähr dafür, daß, wenn Ricci eine Veränderung empfahl, diese auf keinen Fall stilwidrig sein konnte. Wir können also die von Ricci überlieferte Verzierungspraxis ohne weiteres als Grundlage einer heutigen Interpretation übernehmen; von ihr ausgehend werden wir dann eher zu ergänzen als wegzunehmen haben.
Auf jeden Fall bildet die Ricci-Tradition, zusammen mit dem „Traité complet de l’art du chant“ Garcias, die wichtigste Quelle für die Aufführungspraxis der Belcanto-Zeit. In einer Hinsicht ist sie sogar die allerwichtigste; denn sie hat den unermeßlichen Vorteil, daß sie eine mündliche Überlieferung ist. Welche Bedeutung dieser Tatsache zukommt, kann jeder ermessen, der einmal versucht hat, anhand von schriftlichen Beschreibungen eine musikalische oder stimmtechnische Leistung nachzuvollziehen. Denn es ist eine Sache, eine bestimmte Phrasierung oder Stimmgebung vorzuschreiben, eine ganz andere jedoch, die Art, wie man diese Dinge auszuführen habe, verständlich darzulegen. Wie die verschiedenen Stimmfarben klingen sollen, wie man eine reine legato-Linie zu singen habe, wie ein portamento oder eine messa di voce gesangstechnisch hervorzubringen seien – das alles kann man nur durch Vormachen vermitteln. Deshalb ist die mündliche Weitergabe der alten Aufführungspraxis etwas, was durch nichts ersetzt werden kann.
Die Zitate, sowie die biographischen Daten von Cotogni und Ricci sind folgenden Büchern entnommen:
– Nino Angelucci: „Ricordo di un artista“, Roma-Milano, Edizione Teatrale, 1907
– Gino Monaldi: „Cantanti Celebri del Secolo XIX“ in „Nuova Antologia“, Roma o-J-
– „Enciclopedia dello Spettacolo“
– Luigi Ricci: „Maestri, gole e … gola“, Casa editrice G. Ricordi & Co., Roma 1947
– Luigi Ricci: „34 anni con Pietro Mascagni“, Edizione Curci, Milano, 1976